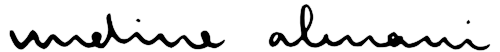Nicht bedürfnisorientiert erziehen, bedürfnisorientiert leben.
Jemand in meiner Familie hat diese Wortgruppe in meinem Kopf hinterlassen. Sie hat auch Kinder und es ging in einem Gespräch darum, wie man die denn nun glücklich macht. Was man so unternehmen kann und dass es schön ist, unterwegs zu sein und wenn man abends nasse, glückliche Kinder hat. Der Ausdruck hinterließ einen Nachhall in meinem Hinterkopf. Er hat so was von Zufriedenheit für mich. Die scheint mir als Elternmensch irgendwie immer seltener zu gelingen. Warum nur?
Ich denke darüber normalerweise nicht so viel nach, weil ich immer viel zu tun habe und mich allgemein ungern darin wälzen möchte, wie viel und wie anstrengend alles ist. Ich möchte auch nicht überlegen, was ich alles tun könnte, damit Dinge sich ändern. Und oft sage ich mir, dass Stress nur eine Phase ist, und irgendwann, in ein paar Jahren, sowieso vorbei.
Frag dich mal.
Vermutlich bin ich mit diesem Denkfehler nicht allein. Es ist reiner Selbstschutz, sich in einer stressigen Lebensphase zu sagen, dass sie irgendwann ja mal enden wird. Nur wann, das ist eben nicht egal. Und fünf Jahre kaum bis keine Zeit für Yoga, Freunde, Café, Liebe, Reisen und Kreativität sind nicht einfach eine Phase. Das ist aufgegebene Lebensqualität. Auch, wenn diese durch Kinderlachen bereichert wird, ist es Zeit, die ich nicht zurück bekomme. Und es ist die Frage, ob und wie ich sie auch mit Familie besser verbringen kann.
Ich werfe dazu also ein paar Psychosätze in den Raum. Wie viele davon kann ich mit „Ja.“ oder „Schon irgendwie.“ kommentieren?
- Ich bin nie zufrieden.
- Ich bin nie vollkommen zufrieden.
- Nichts fühlt sich fertig an.
- Ich weiß nicht mehr, wann ich das letztemal meine ganze Lebensenergie gespürt habe.
- Ich weiß es noch, aber es ist länger als ein Vierteljahr her.
- Am Ende des Tages bin ich unzufrieden mit dem, was ich geschafft habe.
- Beim Gedanken an die Steuererklärung wird mir schlecht.
- Wenn ich an Weihnachten denke, wird mir auch schlecht.
- Ich habe keine Lust auf das nächste Familientreffen.
- Es kostet mich Überwindung, mich gut anzuziehen, zu schminken oder einfach nur aufzustehen.
- Alles ist ein Kraftakt.
Vielleicht denke ich nicht bei allen Sätzen „Ja.“, aber es reicht auch schon einer. Eigentlich sollte es doch so gehen:
- Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben.
- Manchmal gibt es Kleinigkeiten, die besser laufen könnten.
- Ich habe einfach viel zu erledigen, so ist das mit Kindern.
- Heute morgen war ich mal richtig wach und die Sonne kam raus und mein Kind hat gelacht.
- Einmal die Woche ist Date Night und die Babysitterin hat die Kinder.
- Am Ende des Tages bin ich froh, im Bett zu liegen und zu lesen.
- Die Steuererklärung hat diesmal wieder einen vierstelligen Betrag abgeworfen, fuck yeah!
- Weihnachten fliegen wir nach Marokko (Ökos: fahren nach Dänemark, lach).
- Das nächste Familientreffen soll endlich mal schön werden und keine Beerdigung.
- Ich lege meine Klamotten abends raus, ich pflege mich, ich passe auf, dass ich ich selbst bleibe.
- Jede Anstrengung, die ich auf mich nehme, hat am Ende einen Wert.
Zufriedenheit ist ja auch so ein Ideal. Es gehört zum Familienleben. Es ist das, was Menschen zeigen, wenn andere Menschen hin schauen. Manchmal auch in Form „authentischer“ Bilder unordentlicher Wohnungen und zerzauster Haare. Aber die Botschaft ist die gleiche wie bei den Interior-Mamis mit der perfekten Einbauküche in Einbauheim an Einbauwäscheschacht.
Dieses Idealbild von der Zufriedenheit mit sich
Blogger und Elternmagazine erklären uns das homogene Bild der Zufriedenheit in unserem mittelständischen Familienalltag: Kinder machen einfach glücklich. Ein Kinderlachen macht alles wieder gut, was scheiße läuft. Nach einem Tag, an dem die Haarbürste ins Klo fällt, an dem man nur noch müde ist, an dem alles nervt, ist ein Kinderlachen doch die Erlösung. Nach der Geburt sind alle Probleme vergessen, weil man sein Kind sieht (okay, da ist Wahres dran). Und: Wer sich wirklich liebt, dem geht es auch als Familie gut. Eine tolle Beziehung wird durch Kinder nur besser. – Selbst wenn man es weniger absolut formuliert, so ist dieses Bild dennoch offensichtlich das erklärte Ziel der glücklichen Familie. Das Ideal, wofür wir leben. Gute Menschen zu sein und keine schlechte Laune zu haben.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass man zu so etwas nur fähig ist, wenn man wirklich resilient oder vollkommen ignorant ist. Und dass alle, die es nicht sind aber diese Ideale verfolgen, sehr schnell in eine zimelich dysfunktionale Familiensituation geraten. Selten ist das nicht, also muss man auch nicht so tun, als ob das Problem nicht existieren würde. Wir kennen die Scheidungsrate deutscher Ehen und die Trennungsrate unserer Freunde. Wir sehen alle unsere Eltern und was bei ihnen schon schief lief, und Menschen, die in der Bahn ihre Kinder ausschimpfen. Wir sehen uns selbst und wir wissen ganz genau, was wir nicht können. Das macht uns unzufrieden aber nicht gleich zu schlechten Eltern.
Es ist richtig. Das Leben mit Kindern hat viele wunderschöne Momente. Aber Momente sind kein Alltag. Alltag ist die tägliche Arbeit, diese kleinen, zuweundungs- und wissensdurstigen Wesen nicht komplett zu versauen. Sie ins Bett zu bringen mit dem Gefühl, dass der Tag voll und schön war. Sie nass und glücklich zu machen. Und sich selbst dabei nicht zu ignorieren.
Ich komme nicht aus einer heilen Welt und ich lebe auch nicht in einer. Niemand lebt in einer, wenn ich mir die Nachrichten so angucke. Und ich möchte also auch nicht so tun. Ich möchte eine Balance finden in diesem Leben, um damit klar zu kommen, wie anstrengend Elternsein ist und gleichzeitig mein Kind, die Natur und gewisse Dinge und Menschen wertzuschätzen. Und das ohne ständig so zu tun, als ob alles wunderbar und nur eine Frage der Einstellung wäre, wenn ich denn nur mal kurz mein Kind angucke oder genügend Abstriche bei mir oder meinen Werten mache.
Es ist nicht normal
Die Abgeklärtheit mancher Eltern, mit der sie Stress und Mühsal als Normalität darstellen, kotzt mich an. Ein Sprüche-Arsenal der Ignoranz begleitet den Rat, um den ich andere Eltern nicht bitte. Wenn man das nicht will, sollte man sich keine Kinder anschaffen. höre ich, wenn ich sage, dass ich mehr arbeiten möchte. Du bist nicht mehr 25, und das wäre nonmal das ideale Alter dafür. sagt man mir, wenn ich erkläre, dass ich (10 Jahre älter) noch eine Doktorarbeit schreiben will. Fahrt doch nach Österreich, das ist doch viel zu stressig mit der Kleinen. heißt es, wenn wir nach drei Jahren endlich wieder in unsere geliebte Bretagne wollen – mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug. Naja, muss jeder selbst wissen. kommt am Schluss, wenn man zwar nicht zustimmt aber entweder zu faul oder zu sehr in sich selbst verwickelt ist, um eine spruchreife inhaltliche Aussage zu treffen.
Ich kann diese Floskeln nicht mehr hören. Entweder ist Selbstfürsorge wichtig für eine funktionale Familie oder nicht. Wenn wir uns darüber nicht einig werden können, dass sie wichtig ist, ist ein weiteres Gespräch tatsächlich sinnlos. Ich finde sie sogar notwendig. Und in der Konsequenz muss einem einfach klar werden, dass dann elterliche Bedürfnisse genauso relevant sind wie kindliche. Ein Kind wird nicht glücklicher, weil ich ihm mehr „opfere“. Ein Kind ist glücklicher, wenn man in der Zeit, die man mit ihm verbringt, einigermaßen unbeschwert, engagiert und konzentriert ist.
Ich kann nicht unbeschwert sein, wenn ich permanent mein restliches Leben zurückstelle und keine Zeit mehr für mich selbst nehme. Trotzdem werden oft diese beiden, sich doch ausschließenden Dinge gefordert: Einerseits soll man sich aufopfern. Das Kind ist das Allerwichtigste, für das tut man alles, schmeißt alles hin, Zwischenmenschliches, Job, Freizeit, Hobbys. Andererseits soll man zufrieden sein mit diesem Zustand, das ist Mutter sein. Während man sich also mit einem Schwergewicht an seelischen Entsagungen belädt, soll das Kind und die Beziehung zu ihm vollkommen unbeschwert sein. Das ist normal so.
Klar ändern sich Dinge
Ich wil nicht sagen, dass ein Leben sich durch ein Kind nicht stark ändert und gewisse Dinge umgedacht werden müssen. Ich will sagen, dass es manchmal, gerade in diesen ambitionierten, intellektuellen Kreisen, bei Eltern, die alles und nur das Beste für ihr Kind wollen, vielleicht einfach zu weit geht.
An keinem Menschen geht eine dermaßene Veränderung spurlos vorbei. Glaube ich einfach nicht. Das Ideal vom Aufgehen in der Mutterrolle. Und wer fragt, was danach kommt? Wenn die Mutterrolle in ihrer täglichen Intensität nach 18 Jahren weg ist? Wenn Falten, Schulden, Altersarmut, fehlende Energie für all die Dinge, die man immer schön aufgeschoben hat, und all die anderen Probleme real werden? Wenn die „Phase“ vorbei ist.
Okay, vielleicht dauert es nicht ganz 18 Jahre. Gehen wir von dem aus, was Frauen in Deutschland durchschnittlich für akzeptabel halten. Bis Kinder in die Schule gehen, geht die Mutter in Teilzeit. Davor bleibt sie drei Jahre komplett zu Hause. Das ist der Mittelwert dessen, was Frauen für okay befinden und zeigt ganz gut, wie lange Frauen glauben, voll und ganz für ihr Kind da sein zu müssen. Ich möchte jetzt keine Jobdiskussion anfangen. Es geht mir nicht darum, ob man sich entscheidet, zu Hause zu bleiben oder arbeiten zu gehen, auch wenn das sicher Teil des Problems ist. Es geht mir darum, wie viele Frauen sich vermutlich jeden Tag in ihrem Alltag entscheiden, Dinge ihrem Kind unterzuordnen und dadurch sich selbst und ihre Bedürfnisse aufzugeben. Dafür ist diese Statistik symptomatisch. Die wenigsten, die drei Jahre zu Hause bleiben und dann noch weitere vier in Teilzeit arbeiten, werden wohl in der Zeit mit dem Kind zu Hause an ihrer Selbstverwirklichung arbeiten.
Das erzeugt in mir einen kleinen achtsam-feministischen Widerstandsmarsch. Je länger ich ein Kind habe, desto öfter denke ich nämlich: Ich will das machen, was meine kinderlosen Freunde auch machen. Ich will Spaß haben! Ich will frei sein.
Das meine ich nicht egoistisch. Und mir ist klar, dass ich den „Spaß“ mit den Abholzeiten aus der Kita abstimmen muss. Ich kann nicht feiern und trinken gehen, wenn ich morgens früh raus muss – und weil ich noch stille. Nein, das ist nicht der Punkt, und nicht das Problem. Aber ich möchte spontan sagen können: „Wir fahren Freunde besuchen“, „Ich gehe in diese Ausstellung morgen“, oder „Kommt doch einfach vorbei.“ Ich möchte keine dieser Mit Kindern geht das einfach nicht.-Mütterchen sein.
Ich bin es aber oft. Ich (nicht mein Kind) halte mich selbst zurück. Ich lasse Müdigkeit und S-Bahn-Wege darüber entscheiden, welche Freunde ich sehe. Ich wähle den einfachen Weg und nicht den gefühlt richtigen. Mein Aktionsradius ist klein, nicht schön. Wir suchen die Cafés danach aus, ob es darin eine Bank oder ein Sofa gibt und nicht nach dem Kaffee und Stil.
Und sicher, einige dieser Einschränkungen sind ganz normal, ja, wirklich okay so. Dinge ändern sich, wenn man ein Baby hat. Manche Veränderungen aber sind nicht das, was ich für mich mit Kind will. Und definitiv nicht das, was ich anderen Müttern wünsche.
Zurück finden zum eigenen Leben
Im Moment habe ich nicht die perfekte Lösung. Aber ich arbeite an Methoden, die meinen Alltag wieder normal-normal machen und nicht Eltern-the-new-Normal-normal. Der wichtigste Punkt dabei ist Planung. Und gleich danach kommt Routine. – Hier auch ein bisschen Werbung, weil ich meine greifbaren Tools zeigen möchte, also ein paar Affiliate Links. Das heißt aber nicht, dass irgendwie der Inhalt flöten geht. Ich stelle euch nur Dinge vor, die mir wirklich geholfen haben, mein Leben irgendwie besser zu planen.
Planen heißt, dass wir einen Familienkalender eingeführt haben. Ich habe ihn designt, mein Mann füllt ihn sonntags aus, und jeder trägt ein, was an Terminen und Erledigungen anfällt. Das Ding liegt im Flur und gerade testen wir es noch.
Daneben gibt es noch mein Bullet Journal und mein Kakeibo (japanisches Haushaltsbuch). Beide helfen mir so so sehr. Das Bujo ist einfach das beste Ding, um das ganze Jahr im Blick zu behalten und langfristige Aufgaben in kurzfristige Häppchen einzuteilen. Kein digitales Tool kommt in Effizienz hier ran für mich.
Das Kakeibo ist mein liebgewonnenes Budgeting-Tool. Es funktioniert wie ein normales Haushaltsbuch aber mit etwas mehr Platz zum Reflektieren und Planen. Ich habe Kontrolle über meine Ausgaben und ich fühle mich immer gut, wenn ich mir etwas gönne, weil ich weiß, dass ich es kann. Das hat enormen Einfluss auf meine Lebensqualität und ich kann es jeder Mutter mit Geldängsten nur ans Herz legen, sich eins zu kaufen und ein Budget anzulegen. Ich kann es auch jeder Nicht-Mutter empfehlen. Es ist nie zu spät oder zu früh dafür!
Routine ist etwas, das ich nicht gut kann. Also gesunde Routine. Scheißroutine kann ich schon. Heim kommen, seufzen, Hände waschen, Baby aufs Klo setzen, Essen machen – das geht. Abends noch zu 45 min Yoga aufraffen. Lesen statt ins Handy glotzen. Freunden schreiben und ein Treffen ausmachen statt auf Instagram liken… Come on, wir wissen alle, wie echtes Sozialleben funktioniert. Routine braucht Zeit. Man muss es tage- und wochenlang durchsetzen, bis man es drauf hat. Sonst wird man wieder bequem. Eltern sind einfach gerne bequem. Das ist schon eine Kunst, gleichzeitig alles angeblich so einfach wie möglich zu machen, und trotzdem noch gestresst zu sein, oder?
Propeller kosten mich zu viel Kraft
Vielleicht ist diese ganze intensive Kümmerei um die Kleinen und das, was sie angeblich brauchen, auch so eine Art Prokrastination. Wenn man sagen kann, man muss sich ja um sein Kind kümmern, weil man sonst eine beschissene Mutter ist, dann darf man ja gar keine Zeit für sich haben. Wie gesagt: Opfern. Märthyrerscheiße, wenn ihr mich fragt. Du bist eine gute Mutter, wenn du dich um dich kümmerst, und zwar – bis auf lebenswichtige Situationen – zuerst.
Ich will nicht im Kinderzimmer sitzen und mich ärgern, dass ich seit drei Wochen meine Fußnägel nicht geschnitten habe und das Loch im Pullover immer noch nicht geflickt ist. So kann doch kein Mensch schön mit Bauklötzen spielen. Ich will da sitzen und denken: Yes! Nägel geschnitten, Pullover zum Reparieren gegeben, Bild gemalt, Musik gemacht, Franzi zum Geburtstag gratuliert, Projekt abgeschlossen, und mein Kind spielt schön. Ich will ein Power-Irgendwas sein.
Denkhilfen
Power-Irgendwas wird man aber nicht einfach so. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, ehrlich nicht, aber auch nicht super weit davon weg. Was mir im Moment zum Beispiel gut hilft, ist die Ivy-Lee-Technik. Oder meine Variante davon. Im Prinzip nichts anderes, als jeden Abend 6 Dinge aufzuschreiben, die man am nächsten Tag unbedingt erledigen will. Es können auch weniger sein. Ich mag die Zahl 5 zum Beispiel lieber.
Diese Dinge werden dann auch wirklich angegangen und zwar als erstes an diesem Tag (oder zum frühestmöglichen Zeitpunkt) und wenn möglich, ohne Pause. Danach darf entspannt werden.
Ein weiterer Kopftrick ist das Ausbreiten oder „Elaborieren des Tagesablaufs„. Kann man auf dem Papier machen oder im Kopf. Einfach morgens hinsetzen und überlegen, wie der Tag laufen wird. Dabei denkt man an alle möglichen Probleme, die im Laufe des Tages auftreten könnten und was man dann tun würde, wie man sich fühlen würde. Diese Technik bereitet mental darauf vor, wie man reagiert, wenn diese Fälle eintreten. Dafür sollte man 5-10 min jeden Tag aufwenden.
Es gibt noch viel mehr Dinge, die wirklich hilfreich sind und nicht nur das Prinzp „Papier ist geduldig“ aushöhlen. Aber am Anfang steht einfach die Entscheidung, sich selbst nicht als Mutterrolle sondern als Person zu kapieren. Wenn man das nicht kann, wenn man sich nicht abgrenzen kann, dann bringt es auch nichts, Zeug aufzuschreiben.
Ich finde diese Abgrenzung sehr wichtig, auch weil man sie an seine Kinder weiter gibt. Wenn ich keinen Trennstrich zwischen meinen und Flauschis Bedürfnissen ziehen kann, lernt sie, dass Grenzen nicht wichtig sind. Wenn sie immer an erster Stelle kommt, lernt sie, dass Andere und Anderes an zweiter Stelle stehen. Das hat nichts mehr mit bedürfnisorientiert und artgerecht zu tun. Ich bin ein Realo. Mein Haus ist keine Hütte im Wald und mein Essen wächst nicht auf dem Feld, das mir gehört und dem Baum, an dem sich alle bedienen können. Meine Welt ist finanziell und hierarchisch strukturiert – nicht artgerecht.
Für mich ist es kein Argument, dass etwas theoretisch besser sein könnte. Es zählt, was praktisch funktioniert und mordernen Menschen wie mir in ihrem beruflichen und familiären Alltag mit Kindern hilft, nicht, was Menschen mit viel Zeit und ohne Angst vor Altersarmut in ihrer anthroposophischen Hanfblase denken. Ich trage, ich stille, ich liebe genug.
Ich finde, es ist Zeit, sich für sich selbst locker zu machen. Die Bewegung, dass wir unsere Kinder frei und bedürfnisorientiert großziehen wollen, vermisst die Prämisse, dass wir uns selbst erst mal soriteren müssen. Generationen autoritärer Erziehung und ihre Folgen auf uns und unsere soziale Umwelt können nicht einfach ignoriert werden. Genauso wie die Welt, in der wir arbeiten, und damit schön unser ach so natürliches Leben außerhalb der bösen kapitalistischen Welt finanzieren.
Wir sind Teil dieser Welt und in ihr müssen wir klar kommen. In diesem Sinne sehe ich Selbstliebe, Selbstfürsorge und bedürfnisorientiertes Leben (bitte nicht nur Erziehung, also auf Kinder bezogen) als etwas, das in den Alltag passen muss. Ich kann meinen Alltag nicht um ein Ideal herum bauen. Es kann allenfalls als Motivation dienen. Das, was mir aus dem Internet so entgegen kommt, ist aber mehr eine undurchdachte Doktrin des bedingungslos positiven Denkens für mich. Soundso muss es sein, dann ist dein Kind glücklich. Und du auch (ist doch eh dasselbe). Du musst artgerecht, bedürfnisorientiert und wertschätzend erziehen. Du musst Holzspielzeug anhäufen und bei jedem Wetter draußen sein. Dein Leben ist deine Familie, so ist das eben mit Kindern.
Ich bin nicht glücklich, nur weil mein Kind unbeschwert aufwächst und viel lacht
Mein Leben ist in erster Linie mein Leben. Und ob mein Kind glücklich ist, kann ich nur ahnen. Ich kann es grob daran ausmachen, wie viel sie lacht. Sie lacht viel. Und ich kann mir Gedanken darüber machen, ob mein Alltagsstress die Schönheit dessen versaut. Wenn das so ist, muss das zuerst kommen. Denn unsere Lebensqualität ist realer als Dogmen und pseudo-altruistisches Opferdenken, das eine Unterordnung der Mutter unter die Bedürfnisse ihrer Kinder fordert.
Mein Baby kann nass und glücklich sein, weil ich arbeiten gehe, nicht obwohl ich es tue. Mein Baby kann auch mal still sitzen, wenn ich einen Brief schreiben muss oder was auch immer ich mal eben machen möchte, das mir gut tut. Mein Baby bleibt eine Dreiviertelstunde lang bei mir im Zimmer, wenn ich Yoga mache und darf gern mit üben. Aber in dieser Zeit wird mal kurz nicht gemacht, was sie will. Das ist unsere Normalität. Sie besteht nicht darin, dass ich ununterbrochen meinem Kind zugewendet bin. Ich lege bewusst Raum fest für mich, in dem sie ihren eigenen Platz finden muss, und für eine begrenzte Zeit akzeptieren muss, dass ich jetzt nicht auf bestimmte Bedürfnisse von ihr eingehe. Wenn sie aufs Klo muss oder hinfällt und weint, ist klar, dass ich das, was ich mache, unterbreche. Aber es geht darum, dass mal sie, mal ich bestimme, was gerade gemacht wird, und eben nicht, dass ich mich komplett nach ihr richte, meinen Alltag um sie herum baue, und alles weglasse, das marginal langweilig oder nicht besonders kindgerecht ist.
Es muss nicht alles „artgerecht“ sein
Es gibt spannendere Aktivitäten für Babys als einen Cafébesuch oder den Gang ins Lenbachhaus. Aber wenn es mir wichtig ist, dann finde ich Zeit für diese Dinge in meinem Leben – und das Kind muss auch öfter mal mit, weil ich sicher nicht während meiner Arbeitszeit ins Museum gehen werde und mein Mann auch nicht immer kann. Eine Freundin von mir sagte dazu: Ich möchte einfach nichts machen, was meinem Kind überhaupt nicht gefällt. Er langweilt sich dann und quengelt. Ja. Dann langweilt mein Kind sich eben. Sich langweilen gehört zum Leben und macht nicht die Liebe kaputt. Quentelt Flauschi? Manchmal. Ja. Aber sie hat auch gelernt, sich selbst zu beschäftigen, wenn ich etwas mache. Sie sitzt dabei nicht traurig und vernachlässigt in der Ecke und leidet. Sie malt oder spielt eben. Wir müssen ja auch eine halbe Stunde zur Arbeit pendeln, in einer vollen S-Bahn und einem noch volleren Bus. Stellt irgendjemand die Notwendigkeit davon in Frage? Nein. Warum dann darüber diskutieren, ob ich mal etwas für mich tun darf und das Kind mitspielen muss? In der S-Bahn habe ich keine Lust auf eine Szene. Und ich hole auch nicht sofort meine Brust oder Essen raus, wenn sie mal weinerlich wird. Zu Hause ist es nicht anders. Es gibt Zeiten, in denen ich auf diese Art für sie da bin, und Zeiten, in denen ich es nicht bin, weil ich mich um mich selbst kümmern will.
Ist das artgerecht? Keine Ahnung. Aber es tut gut, und nach allem, was ich so beobachte, quält sie sich nicht, wenn sie während ich Yoga übe, Bücher „liest“ oder ihre Babypuppe bespielt. Sie kann mittlerweile (19 Monate) übrigens den herabschauenden Hund und sogar die Brücke. Sieht echt cool aus!

Letztlich bin ich einfach gegen Dogmatik. Gegen diese immer wieder aufpoppenden Trends. Im Moment ist es bedürfnisorientiert und artgerecht. In drei Jahren ist es was anderes. Ich ziehe meine Schlüsse aus diesen Theorien und nehme das an, was für mich geht. Aber ich habe gelernt, dass ich mit der Interpretation von bedüfnisorientiert, die einige Frauen so plakativ leben, überhaupt nicht konform gehe. Meine Bedürfnisse sind wichtig, und zwar nicht nur dann, wenn sie mit der momentanen Stimmung meines Kindes zusammen passen. Mal machen wir das, was ich will, mal das, was sie will.
Ich lasse sie häufig kleine Entscheidungen treffen. Was sie anziehen möchte, ob wir raus gehen, auf welchen Spielplatz wir gehen, ob wir zum Springbrunnen gehen, was es zu Essen gibt, ob wir Baba anrufen, ob sie schlafen gehen muss oder noch eine halbe Stunde spielen darf (ich habe Gleitzeit). Ich nehme mir manchmal frei und wir machen einen schönen langen Mutter-Tochter-Tag. Es fehlt nichts, nur weil ich nicht sofort und immer auf alles reagiere.
Und ich habe auch verstanden, dass es da Schattierungen gibt. Sicher ist nicht jede Interpretation von attachment parenting gleich. Trotzdem leben am Ende nicht wenige, vor allem Frauen, ein Modell, das für mich so nicht passt, und in dem die Bedürfnisse der Frauen sehr wohl sekundär gemacht werden. Nur weil man sich nicht persönlich betroffen fühlt oder hier und da Kontraste sieht, heißt es nicht, dass dogmatische Modelle folgenlos sind.
In diesem Sinne: Du denktst nach. Du zweifelst. Du suchst die besten Lösungen für dein Kind. Alles Zeichen, dass du vermutlich keine komplett beschissene Mutter bist. – Du bist genug. Jetzt musst du das Gleiche nur noch für dich selbst tun.